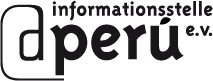Mennonitische Gemeinden breiten sich auch im peruanischen Regenwald immer mehr aus. Dies führt zu Landstreitigkeiten mit indigenen Gemeinden.
Sie gelten als religiöse Minderheit, die in der Geschichte immer wieder verfolgt und unterdrückt wurde. Der ehemalige katholische Priester Menno Siemens gründete im Jahr 1525 die erste mennonitische Gemeinde in Zürich. Auf Grund der Verfolgung wanderte ein Großteil nach Holland und Norddeutschland aus, bald auch ins heutige Polen. Im 18. Jahrhundert nahmen einige Kolonien das Angebot der russischen Zarin Katharina an, wanderten in die Wolgaregion aus und ließen sich auf der Krim nieder. Wegen Verfolgung und Deportationen in die Gulags – die Todeslager unter der Herrschaft Stalins – begann die große Flucht nach Kanada und in die USA, später nach Bolivien, Mexiko, Paraguay, Brasilien, Argentinien, Belize und Peru.
Nach Lateinamerika kamen die ersten mennonitischen Familien anfangs der 20er Jahre. Rund 3000 Personen ließen sich hauptsächlich im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua nieder. Heute leben ungefähr 120.000 Mennonit*innen in Mexiko. Knapp 100 Jahre später wanderten die ersten Mennonit*innen nach Peru aus – und möchten sich dort offenbar nicht an geltende Rechte halten.
Mindestens 7000 Hektar Regenwald zerstört
In Deutschland setzen sich die Mennonit*innen für Frieden sowie für soziale und Umweltgerechtigkeit ein. Das sieht in Peru anders aus, wo sie sich im nordöstlichen Regenwald niederließen und zwischen 2017 und 2023 mindestens 7000 Hektar intakten Regenwald zerstörten. Ihre Kolonien in der Region Ucayali heißen Vanderland, Österreich, Neujerusalem, Providencia, Caimito oder Masisea. Sie liegen in den Territorien der indigenen Shipibo-Konibo und Ashéninka. Besonders betroffen war die indigene Dorfgemeinschaft Toabilonia, die vor der Ankunft der Mennonit*innen von der peruanischen Regierung endlich Land zugesprochen bekommen hatte, das zuvor von Drogenbanden kontrolliert worden war.
Andere Kolonien befinden sich in der Region Madre de Dios im südöstlichen Peru. Einer der mennonitischen Sprecher, Peter Dyck, erklärte gegenüber Journalisten des Medienportals Convoca: „Holz ist wichtig, aber es gibt genug Bäume in Peru. Peru braucht Nahrung und keine Bäume. Wir sind zum Arbeiten gekommen. Wir suchen mehr Land zum Leben und Produzieren. Warum brauchen wir so viele Bäume, wenn sie nichts produzieren?“
Die Wälder Amazoniens sind für diese Siedler*innen ein Raum, der nur durch intensive Landwirtschaft und Viehzucht einen wirklichen Wert erhält. Dabei bauen die mennonitischen Gemeinden hauptsächlich Soja an, und zwar genetisch verändertes Soja, obwohl in Peru bis zum Jahr 2035 die Aussaat von gentechnisch manipulierten Pflanzen verboten ist.
Sonderstaatsanwaltschaft ermittelt wegen Waldzerstörung
Die Mennoniten der „ersten Stunde“ waren bekannt für ihre karierten Hemden, Latzhosen und einfachstes landwirtschaftliches Gerät. Heutzutage sieht das anders aus. Die mennonitischen Siedler*innen in Peru arbeiten mit schwerem Gerät wie Raupenbagger und setzen auf Agrarchemie.
Für die Mennonit*innen in Peru gilt es, ihre „ethnische Reinheit“ zu bewahren. Ihre eigenen Überzeugungen stehen für sie über den Gesetzen der Länder, in denen sie leben. Bereits im Jahr 2020 führte die Sonderstaatsanwaltschaft für Umweltkriminalität eine Untersuchung in der Kolonie Neujerusalem in der Urwaldregion Ucayali durch. Er hielt in seinem Protokoll fest, dass vier blonde Männer mit einem starken Raupenbagger große Schneisen in den Urwald schlugen. Es handelte sich um Heinrich Klassen, Johan Friesen, Cornelius Schmitt und Johann Dyck. Sie erklärten ihm, dass sie aus Belize gekommen waren und zur religiösen Gruppe der Mennoniten gehörten. Weil ihre Kolonie keine Erlaubnis für diese Art der Landnutzung hatte, wurde die Abholzung zur Anklage gebracht. Doch die geforderte Untersuchungshaft wurde von den zuständigen Richtern abgelehnt. Nachdem mehrere Eingaben bei den zuständigen Stellen wie Bürgermeistern und der Regionalregierung nichts bewirkten, erstatte im August 2023 die Organisation der betroffenen Indigenen Shipibo-Konibo-Xetebo (COSHIKOX) Strafanzeige wegen der Waldzerstörung auf ihrem Territorium. Denn das Recht der indigenen Dorfgemeinschaft auf vorgängige Konsultation (consulta previa), das in der peruanischen Gesetzgebung verankert ist, wurde in diesem Fall missachtet. Dieser Klage wurde im Dezember 2023 vom Obersten Gericht der Region Ucayali stattgegeben, die Ermittlungen laufen.
Der peruanische Regenwaldexperte Marc Dourojeanni wie auch das Medienportal Convoca bestätigen die Beschwerden indigener Organisationen, dass die Landvergabe an die mennonitischen Kolonien durch die staatlichen Behörden rechtswidrig war. Dabei wird – wie oft in Peru – Korruption vermutet. Convoca konnte dies durch Einsicht in entsprechende Dokumente bestätigen, wo die Namen von 25 Personen – Beamte der Regionalregierung oder ehemalige Bürgermeister – als Verantwortliche für die Erteilung illegaler Abholzlizenzen und Landtitel gelistet waren. Im Januar 2024 verbot das Regionalgericht von Ucayali der Mennonitenkolonie im Bezirk Masisea die Fortsetzung des Baus eines weiteren Straßenabschnitts von 2,5 Kilometern Länge und 20 Metern Breite durch den Regenwald. Nun gilt es, die Entwicklung der Klagen gegen die umweltzerstörenden Aktivitäten der Mennonit*innen in Peru weiterhin aufmerksam zu verfolgen.